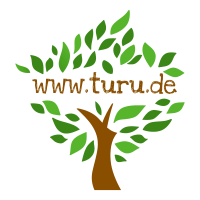UmweltDialog Greenpeace
12.12.2025 04:00
Die Welt droht, am textilen Abfall zu ersticken. 120 Millionen Tonnen Textilmüll fallen weltweit jährlich an, wovon bislang lediglich 1 Prozent recycelt wird. Zeit zum Handeln. Das hat auch die EU erkannt und sich entschieden, die Textil- und Bekleidungsbranche grundlegend zu verändern. Die Zielsetzung: Bis zum Jahr 2030 soll die Branche ressourcenschonend und kreislauffähig produzieren. Zur Beschleunigung dieses Wandels werden in den nächsten Jahren europaweit zahlreiche neue Gesetze erlassen. Doch wie kann diese Transformation erfolgreich in die Tat umgesetzt werden? Genau dieser Frage geht das Forschungsprojekt RETRAKT nach.
12.12.2025 03:00
Eine neue Studie der Leibniz Universität Hannover und der Technischen Universität München zeigt, wie sich das Konzept der 15-Minuten-Stadt um echte Biodiversität erweitern lässt. Kleine Grünflächen, vielfältige Pflanzen und digitale Werkzeuge könnten Städte nicht nur lebenswerter machen, sondern auch Tiere und Pflanzen besser schützen – trotz knapper Flächen und Budgets.
11.12.2025 14:57
Die große Koalition aus CDU, CSU und SPD hat sich auf eine drastische Einschränkung des Umweltverbandsklagerechts geeinigt. Unter dem Vorwand der Beschleunigung von Infrastrukturprojekten droht einem der wichtigsten Instrumente des Umweltschutzes das faktische Aus – ein Vorhaben, das juristisch höchst fragwürdig erscheint und gegen internationale Verpflichtungen verstoßen könnte.
11.12.2025 04:00
Auf der COP 30 in Belém haben Regierungen Milliarden-Programme vorgestellt, um degradierte Böden wiederherzustellen und Düngemittel klimafreundlicher zu machen. Die Ernährungskrise verschärft sich seit sechs Jahren – obwohl genug Nahrung für zehn Milliarden Menschen produziert wird.
11.12.2025 03:00
Der Verband Klimaschutz-Unternehmen und die Universität Kassel stellen erste Ergebnisse des im Mai gestarteten Kooperationsprojekts „Wege zum Nachhaltigkeitsreporting mit KI“ vor. Ziel des Projekts ist es, die Erfassung von THG-Emissionen von eingekauften Waren und Dienstleistungen aus Scope 3.1 mit KI zu vereinfachen. Die KI automatisiert Einkaufsdaten und übersetzt sie in klimarelevante Informationen. Damit reduziert sich die Zeit für die Datenanalyse um bis zu 80 Prozent.
10.12.2025 04:00
Während Extremwetterereignisse von Sumatra bis Sri Lanka Tausende Menschenleben fordern und ganze Existenzen vernichten, klafft bei der Klimaanpassung in Asien eine Finanzierungslücke von 1,7 Billionen US-Dollar jährlich. Experten warnen: Ohne grundlegende Reformen bei Governance und Investitionen werden die Verluste exponentiell steigen.
Fehler – folgender Fehler trat beim Abrufen der URL https://www.greenpeace.de/rss.xml auf:
cURL error 22: The requested URL returned error: 403